|

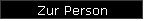







| |
Es war spät und es war kalt in Hamburg
Hamburg im Februar, 15 Grad minus – und es war Nacht. Das leer
stehende alte Wohnhaus in Altona, am Ende der Reeperbahn, das von einigen
Junkies besetzt wurde, sollte uns heute als Nachtquartier dienen.
Es stank nach Urin. Die Toiletten wurden zwar benutzt, aber es gab kein Wasser
zum Spülen. Obwohl ich in der zweiten Etage eine angejahrte freie Matratze
gefunden hatte, konnte ich nicht schlafen; mir war einfach zu kalt. Meine
Gedanken kreisten um morgen. Werde ich mir ohne Probleme meinen Stoff besorgen
können? Außerdem fragte sich jeder, wie lange wir hier noch würden übernachten
können, da das Haus ja abgerissen werden sollte. Plötzlich Lärm, laute Stimmen.
Polizei!
„Aufstehen und raus hier, ihr Scheißtypen.“
Unsanft wurde ich durchs Haus geschubst. Draußen traf ich auf ein paar Freunde.
Bei nächstbester Gelegenheit hauten wir ab, so schnell wir konnten, ehe die
Bullen noch darauf kamen, uns zwecks Feststellung unserer Personalien mit zur
Wache zu nehmen.
Ich war erst sechzehn Jahre und somit minderjährig. „Minder“, wie sich das
anhört, wie „geistig minderbemittelt“. Seit zwei Jahren lebte ich nun schon als
Junkie auf Hamburgs Straßen. Keiner suchte oder vermisste mich. Oft wünschte ich
mir, mein Vater würde mich aus der Szene rausholen. Die meisten von uns waren
noch unter einundzwanzig, die damalige Klassifizierungsgrenze in voll- und
minderjährig. Unsere Seelen, die bereits zu viel Schmutz, Erbärmlichkeit und
Kälte hatten erleiden müssen, befanden sich allerdings schon längst im
Rentenalter.
Es war ein Uhr dreißig, die U-Bahn fuhr schon nicht mehr. Der letzte Bus in
Richtung Fuhlsbüttel war auch schon weg. In Fuhlsbüttel wohnte meine Oma.
Manchmal ließ sie mich rein, manchmal nicht. Kein Wunder, ich hatte sie wohl
schon zu oft enttäuscht. Wir gingen weiter in Richtung Grindel.
„Dort kenne ich eine Wohngemeinschaft“, sagte ich in die grausige Kälte hinein,
also stiefelten wir dorthin.
Mir wurde schnell klar, dass ich nicht die richtigen Klamotten trug für diese
kristallklare Nacht; es war zu kalt, um zu schneien. Der Mond und die Sterne
zeichneten sich deutlich am Himmel ab, was die Dunkelheit und Ungemütlichkeit
der alten Häuser in den Straßen noch unterstrich. Die letzten warmen Lichter in
den Fenstern schienen schon lange aus zu sein. Nach und nach verkleinerte sich
unsere Gruppe. Einige gingen in offen stehende Treppenhäuser, um zu warten, bis
die U-Bahn wieder fuhr. Andere kamen bei irgendwelchen Freunden unter, bei denen
sie nun wirklich niemanden mehr mitnehmen konnten.
Als ich am Grindel ankam, war ich allein. Da von der WG keiner mehr aufmachte,
ging ich ein paar Häuser weiter in ein offenes Treppenhaus. Ich schlich mich in
den Keller, damit ich nicht gleich vom Ersten, der zur Arbeit ging, wieder
hinausgeworfen wurde. Unter der Treppe lagerte ein weiches Dämmmaterial. Ich
machte es mir bequem und deckte mich mit einem Teil davon zu. Es half ein wenig
gegen die Kälte von außen. Ich schlief ein.
Mein Schlaf konnte nicht lange gedauert haben, als ich wieder wach wurde, juckte
mein ganzer Körper wie verrückt. Dummerweise hatte ich mich in Glaswolle gelegt,
und ich fror. Die Stadt erwachte zu neuem Leben, während sich bei mir der Entzug
deutlich bemerkbar machte. Ich spürte die hoffnungslose Grausamkeit der
Gegenwart. Die Sucht hielt mich stets in einem immer wiederkehrenden Kreislauf
von Euphorie und Depression, einer fortschreitenden körperlichen und seelischen
Verwahrlosung. Das Schlimmste war, dass ich einfach nicht wusste, welcher Weg
aus dieser Hoffnungslosigkeit hinausführt. Zudem konnte ich mir nicht
vorstellen, mit den Drogen aufzuhören, und es schien auch niemanden zu
interessieren, wie ich lebte.
Der kleine Freddy
Eigentlich war ich immer der Meinung, dass meine Kindheit bis
zu meinem sechsten Geburtstag ganz in Ordnung war. Ich wohnte bei meinen
Großeltern, den Eltern meines Vaters, während mein Bruder bei den Eltern meiner
Mutter lebte. Unsere Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich eineinhalb
Jahre und Jens gerade ein paar Monate alt war. Wir lebten in Langenhorn, ein
Stadtteil am nördlichen Rande von Hamburg, der damals überwiegend aus dem
psychiatrischen Krankenhaus Ochsenzoll bestand. Eine ziemlich autarke Anstalt
mit eigener Landwirtschaft und Schweinezucht. Es gab eine eigene Stromversorgung
durch ein riesengroßes Maschinenhaus, in dem mit Koksfeuerung Dampfmaschinen
betrieben wurden, die Strom erzeugten. Es gab neben einem Gemüsegarten, der die
Ausmaße von mindestens fünf Fußballfeldern aufwies, auch Getreide- und
Kartoffelfelder. Wir Kinder konnten uns überall bedienen. Rüben schmecken, wenn
man sie mit dem Taschenmesser säubert, richtig gut. In dem Gemüsegarten fanden
wir ganze Erdbeerplantagen, die nur auf uns warteten. Alle an beiden Straßen auf
unserer Seite der Anstalt liegenden Häuser gehörten den Bediensteten des
Krankenhauses. Mein Opa war Krankenpfleger, wie mein Vater auch, bevor er hier
wegzog. Sämtliche Nachbarn arbeiteten irgendwie in der Anstalt: in der
Verwaltung, der Pflege oder der Bewirtschaftung.
Die wunderschönen alten Häuser beherbergten jeweils zwei Wohnungen auf jeder
Seite übereinander, aber die meisten hatten so große Familien, dass ihnen beide
Wohnungen zugeteilt worden waren. Aus der Küche führte eine Treppe hinunter über
den Hof zum Stall, der den gleichen Stil wie das Haus aufwies. Hier gab es die
Toilette, was eigentlich nur im Winter unangenehm war. In unserem Stall
tummelten sich Hühner, Kaninchen und sogar einmal ein Schwein. Es schloss sich
ein sehr großer Garten an, in dem Obstbäume, Blumen und Gemüse wuchsen.
Am Ende des Gartens wuchs eine hohe Hecke, die ein Loch aufwies, durch das wir
Kinder auf allen vieren hindurchschlüpfen konnten, um in den Gemüsegarten der
Anstalt zu gelangen. Wir, das waren Harold, mein bester Freund, sein Bruder
Klaus Dieter, wir nannten ihn immer Goofy, und Harolds Schwester Christina, die
allgemein nur „Süße“ gerufen wurde.
Unsere Häuser standen direkt nebeneinander. Mein Bruder Jens lebte eine Straße
weiter, nur fünf Minuten entfernt. Im Herbst, wenn die Kartoffelfelder
abgeerntet waren, nahm mein Opa mich mit zum Stoppeln. Bewaffnet mit einer Hacke
ging er auf dem Feld noch einmal durch die Reihen und buddelte die Kartoffeln
aus, die bei der Ernte übersehen worden waren. Die Sonne stand manchmal schon
sehr niedrig, wenn der Sack gefüllt war. Es roch erdig, und überall auf dem
Acker brannten kleine Feuer, in denen das trockene Kartoffelkraut verbrand
wurde. Mein Opa und ich saßen an einem Feuer und aßen gare Kartoffeln, die wir
vorher in die Glut gelegt hatten.
„Wahrscheinlich wird Oma wieder schimpfen, dass du so dreckig bist und so nach
Rauch stinkst!“, bemerkte Opa.
Den Geruch nach feuchtem Ackerboden, Feuer und leicht angebrannten Kartoffeln
mag ich immer noch. Ich liebte diese Zeit, aber mehr noch den Sommer, wenn die
Kornfelder im leichten Wind wogten, der Himmel blau war und die Lerchen am
Himmel ihre Lieder sangen. Oft lag ich dann mit Harold irgendwo im Gras; wir
schauten in den Himmel und versuchten, in den weißen Wolken Tiere zu erkennen.
Manchmal roch es nach frischem Heu oder grünem Grass. Es duftete nach Blumen,
ich spürte die Wärme auf meiner Haut, während ich die Welt mit dem ganzen Körper
in mich aufnahm.
|